Freie MusikerInnen in Deutschland werden bis auf wenige Ausnahmen zu schlecht bezahlt. Diese Tatsache ist kein Geheimnis und dürfte auch kaum angezweifelt werden. Nach einer Ausbildung, die sich – wenn man die Zeit in der Musikschule hinzuzählt – über zwanzig Jahre hinziehen kann, landen viele von uns unvorbereitet auf dem freien Markt und werden plötzlich mit harten Realitäten konfrontiert. Musikalisch sind wir überqualifiziert, während die Begriffe „Arbeitsvertrag“, „Selbstmanagement“ und „Vertragsverhandlungen“ für uns Fremdwörter sind. In diesem Artikel wollen wir der Frage nachgehen, warum das so ist und wie man es besser machen könnte.
Wer erwartet, dass wir an dieser Stelle über die fehlgeleitete Kulturpolitik schimpfen, den müssen wir enttäuschen. Das Problem der prekär beschäftigten MusikerInnen ist viel komplexer. Wir glauben, dass wir MusikerInnen selbst nicht ganz unschuldig an der verfahrenen Situation sind. Um der Sache auf den Grund zu gehen, werden wir aber zunächst etwas weiter ausholen. Also bleibt dran und viel Spaß beim Lesen!
Wer bezahlt unsere Renten?
Fangen wir einmal ganz vorne an und stellen uns eine Frage, die auf den ersten Blick nichts mit dem Thema zu tun hat: Wie werden eigentlich die Renten in Deutschland finanziert? Die Antwort scheint offensichtlich: Als fest angestellte(r) ArbeitnehmerIn zahlt man einen Teil seines Gehalts in die staatliche Rentenkasse ein, um später eine Rente ausgezahlt zu bekommen. Selbstständige und FreiberuflerInnen müssen privat vorsorgen. Doch ganz so einfach ist es leider nicht: Demografischer Wandel, Inflation und nicht zuletzt die Arbeitsmarktreformen haben dazu geführt, dass heute die Renten durch die gesetzliche Rentenversicherung allein nicht mehr finanziert werden können. Nun könnte man die Renten einfach senken, doch dem stehen gesetzliche und politische Hürden im Weg. Als Lösung dieses Problems wird daher ein Teil der Renten über den Bundeshaushalt ausgeglichen. Aktuell beträgt dieser Zuschuss des Bundes etwa 30 %.
Moment mal, wird der Bundeshaushalt nicht über Steuereinnahmen finanziert? Ganz genau! Und Steuern zahlen nicht nur ArbeitnehmerInnen, sondern auch – zu einem nicht unerheblichen Teil – Selbstständige und FreiberuflerInnen. Wir KünstlerInnen haben dabei noch Glück, weil wir über die Künstlersozialkasse in die Rentenkasse einzahlen und später wenigstens auf eine kleine gesetzliche Rente bauen können. Doch für alle anderen Selbstständigen gilt: Obwohl sie nicht in die Rentenkasse einzahlen, werden aus ihren Steuern die Renten mitfinanziert, die sie selbst nicht erhalten werden! Das ist wegen einiger lästiger Paragrafen des Grundgesetzes (Stichwort Gleichbehandlungsprinzip) problematisch und Rechtsexperten warnen davor, dass der Anteil des Bundeszuschusses nicht über 50 % steigen darf.[1]Sascha Lobo: „Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative“, veröffentlicht am 19.12.2020 auf spiegel.de
Was hat das nun mit den schlechten Arbeitsbedingungen für KünstlerInnen zu tun? Auf den ersten Blick erscheint es paradox, dass besonders öffentlich finanzierte Stellen wie die der MusikschullehrerInnen in Honorarverträge umgewandelt werden. Der Staat kann sich dies eigentlich nicht leisten, weil so der Anteil derer, die nicht in die Rentenkasse einzahlen, weiter steigt. Die Erklärung liegt in der Idee, die ursprünglich hinter dem Honorar lag.
Das Honorar als Ehrensold
Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff „Honorar“? Um diese Frage zu beantworten, muss man weit zurückblicken, genauer gesagt: Bis ins Alte Rom. Dort erhielten Rechtsberater kein festes Gehalt, sondern boten ihre Arbeit kostenlos an, um ihr Ansehen zu steigern und ihre Chance auf eine politische Karriere zu erhöhen. Es war erlaubt, kleine (Geld-)Geschenke anzunehmen, die als „honorarium“ (lat.: „honor“ → „Ehre“) bezeichnet wurden. Daraus entwickelte sich mit der Zeit das feste Honorar, das einem für viele Tätigkeiten sogar rechtlich zustand.[2]vgl. Wikipedia-Eintrag „Honorar“ Zwar hat sich der Charakter des Honorars über die Jahrhunderte sehr verändert, doch ein Kernmerkmal ist bis heute erhalten geblieben: Da das Honorar kein Gehalt oder Lohn im juristischen Sinne ist, herrscht bei vielen immer noch die Meinung vor, ein Honorar bilde nicht den Gegenwert der Arbeitsleistung ab, sondern sei etwas Zusätzliches, quasi ein „Ehrensold“, den man sich mehr durch seine Lebensleistung als durch seine tatsächliche Tätigkeit verdient hätte. Dementsprechend gibt es wenig juristische Vorgaben bezüglich Honoraren bzw. Honorarverträgen.
Das ist besonders problematisch, wenn Arbeitskräfte dauerhaft auf Honorarbasis beschäftigt werden, wie es an Musikschulen häufig der Fall ist: Auf der einen Seite kann der Auftraggeber die Verträge relativ frei und individuell gestalten – was, wie kaum überraschen dürfte, selten zu Gunsten der AuftragnehmerInnen geht –, auf der anderen Seite müssen juristische Fragen immer im Einzelfall geklärt werden, sprich: Eine Honorarkraft muss klagen, um festzustellen, ob ihr Honorarvertrag gesetzeswidrig ist. Bei festangestellten ArbeitnehmerInnen ist das deutlich einfacher: Unzählige Paragrafen des BGB schränken die Möglichkeiten der ArbeitgeberInnen zur Ausbeutung ohnehin ein (Kündigungsfristen, Mutterschutz, etc.) und es lassen sich leichter gewerkschaftliche Aktionen koordinieren, wenn alle Angestellten ähnliche Arbeitsverträge haben.
Von der Festanstellung zum Honorarvertrag
Erinnern wir uns ein paar Jahrzehnte zurück: In den 1980ern und 1990ern war das Wirtschaftswunder lange vorbei, stattdessen gab es Ölkrise, Kohleausstieg und Wiedervereinigung. In der Folge ging immer mehr Kommunen das Geld aus. Aufgrund der komplexen Steuergeld-Verteilung in Deutschland (Stichwort Föderalismus) konnten die Löcher in den kommunalen Haushalten nicht einfach mit Bundesmitteln gestopft werden. Gleichzeitig stieg die Nachfrage nach kulturellen Angeboten. Doch da den Musikschulen wenig bis gar kein Geld für diese Bildungs- und Kulturoffensive zugestanden wurde, musste man sich anders behelfen. Und so kam die Idee auf, dass man ja statt der bis dahin üblichen – aber teuren – Festanstellung eine Stelle in viele kleine Honorarverträge aufteilen könnte. Das hatte den Vorteil, dass man kaum für Zusatzarbeit der Honorarkräfte wie Unterrichtsvorbereitung zahlen musste und man dazu noch sämtliche Sozialabgaben einsparte. Die Rheinische Musikschule Köln beispielsweise konnte bei gleichbleibendem Budget ihr Unterrichtsangebot so ausbauen, dass sich die Zahl der SchülerInnen zwischen 1994 und 2018 verdoppelte.[3]„Nachgefragt: Honorarkräfte der Rheinischen Musikschule wehren sich!“, veröffentlicht am 31.07.2018 auf koeln-bonn.dgb.de
Diese Idee war ursprünglich gar nicht so schlecht, wie es klingt, denn im Kultursektor gibt es naturgemäß einen hohen Grad an Spezialisierung. Das heißt: Ein fest angestellter Tuba-Musikschullehrer kommt beispielsweise selten auf eine volle Auslastung, da es logischerweise (bedauerlicherweise?) nicht so viele Kinder gibt, die Tuba lernen wollen wie beispielsweise Gitarre. Er kann aber auch nicht einfach zusätzlich Posaune und Trompete unterrichten, wenn er diese Instrumente nicht studiert hat. Bei einem kleinen Budget kann eine Musikschule also nicht endlos verschiedene Unterrichtsangebote im Programm haben. Bei vielen kleinen Stellen mit geringer Stundenzahl können sich die Musikschulen dagegen wesentlich breiter aufstellen. Eine Tubaklasse mit drei und eine Posaunenklasse mit vier SchülerInnen sind kein Problem mehr, während man sich bei einer fest angestellten Lehrkraft wahrscheinlich für ein Fach hätte entscheiden müssen (vermutlich für Gitarre…).
Die ursprüngliche Idee war also möglicherweise gar nicht, MusikerInnen in die Freiberuflichkeit zu zwingen. Und hier wird die Bedeutung des Wortes Honorar wichtig: Wahrscheinlich ging man davon aus, dass ein(e) MusiklehrerIn niemals nur von Honorarverträgen leben konnte oder wollte! Wie im Alten Rom sollte das Honorar als Zusatzverdienst zum eigentlichen Broterwerb dienen. Die Musikschulen und die PolitikerInnen als deren Geldgeber bauten wohl darauf, dass man als MusikerIn schon irgendwo fest angestellt sei und das Unterrichten auf Honorarbasis somit zur „ehrenvollen“ Zusatztätigkeit würde. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Orchester bei ihren Aushilfen und Musikhochschulen bei ihren Lehrbeauftragten. Doch wie kam man auf die Idee, dass die Musikwelt heute noch so aussähe? Wir fürchten, dafür sind die MusikerInnen selbst verantwortlich.
Die verzerrte Eigenwahrnehmung der klassischen Musik
Die klassische Musik war bis lange nach dem zweiten Weltkrieg die „Popmusik“ der Gesellschaft. So wie man heute die neuesten Songs von Ariana Grande, Justin Bieber oder Weeknd mitpfeifen kann, kannten unsere Eltern und Großeltern die Texte und Melodien aus beliebten Opern und Operetten auswendig. Die Schlagerstars der 1950er und 1960er hatten selbstverständlich klassische Gesangsausbildungen; auf ihren Platten fanden sich neben deutschen Schlagern auch Arien aus „Die lustige Witwe“ oder „Die Fledermaus“. Gleichzeitig war Musik etwas für reiche Leute: Ein Instrument zu lernen kostete Geld, daher war die Nachfrage nach guten LehrerInnen begrenzt. Doch dann kamen auch andere Bevölkerungsschichten auf die Idee, Musik machen zu wollen. Die ersten Rockbands tauchten auf und die Jugend sang statt „Da geh’ ich ins Maxim“ plötzlich „I can’t get no satisfaction“.
Wir haben den Eindruck, dass die klassische Musik diesen Wandel bis heute nicht verkraftet hat. Unter klassischen MusikerInnen gilt klassische Musik immer noch als das Höchste; man muss sie weder vermarkten noch erklären. Klassische Musik spricht für sich und wer das nicht erkennt oder versteht, hat eben keine Ahnung. Ein schönes Beispiel, das jede(r) MusikerIn kennen dürfte, ist, wenn einem im Unterricht erklärt wird, man würde der Musik nicht „gerecht“ werden. Wir erinnern uns noch gut an einen Meisterkurs aus unserer Studienzeit, bei dem eine Professorin einer Studentin mitteilte, so wie sie spiele sei es „schade für die Musik“. Die Musik wird hier personifiziert; man kann ihr huldigen, sie aber auch missachten und beleidigen. Dieser Meinung ist auch Will Cheng, Chair and Associate Professor of Music am US-amerikanischen Dartmouth College. In seinem Buch „Loving music till it hurts“[4]Will Cheng: Loving music till it hurts, Oxford University Press, 2019, S. 20-27 schreibt er:
„Wir lieben Musik so sehr, dass wir über sie als lebendes, fühlendes Wesen sprechen. (…) Aber hat ein musikalisches Werk Würde? Kann es Schmerzen spüren? Hat es Rechte? (…) Wenn wir die Vibrationen der Musik in unserem Körper fühlen, bewegt sie uns dazu, einfühlsam zu reagieren. Wenn wir den Eindruck haben, dass unserer geliebten Musik weh getan wird, tut es auch uns ein bisschen weh. (…) Noch schlimmer: Das Beschützen der Lieblingsmusik könnte einen dazu bringen, einen Star zu verteidigen, dem mehrfach Sexualverbrechen vorgeworfen wurden, und weiterhin sein musikalisches Schaffen zu fördern.“„We love music so much that we might talk about it as an animate, sentient being. (…) But does musical work have dignity? Can it sense pain? Does is have rights? (…) As music vibrates our bodies sympathetically, it moves us to react empathetically. When we perceive our beloved music hurting, we hurt a little, too. (…) More grievously, a protectiveness of your favorite music could motivate you to defend and continue to patronize the music of a superstar who has been multiply accused of sex crimes.“– Prof. Will Cheng
Der Musik nicht gerecht werden
Aus dieser Haltung heraus entsteht schnell der Verdacht, ein(e) MusikerIn ohne solistische Weltkarriere habe es nicht geschafft, der Musik „gerecht“ zu werden. Wir beobachten schon länger, dass dadurch eine unangenehme Zweiteilung der Szene entsteht: Auf der einen Seite stehen die MusikerInnen in den großen Orchestern, die ProfessorInnen und die SolistInnen, auf der anderen Seite die freien MusikerInnen wie Orchesteraushilfen, Lehrbeauftragte und Honorarkräfte. Das Problem dabei ist, dass die Interessen der Musikszene nach außen fast ausschließlich von Angehörigen der ersten Gruppe vertreten werden. Logischerweise bilden diese Interessen aber eher die Bedürfnisse dieser Gruppe ab. Anders ausgedrückt: Ein(e) ProfessorIn wird sich wohl eher nicht für bessere Arbeitsbedingungen von Honorarkräften oder Orchesteraushilfen einsetzen (außer seine oder ihre Aufmerksamkeit wird durch persönliche Verstrickungen auf das Thema gelenkt).
Was gerne vergessen wird: Diese erste Gruppe wird massiv subventioniert, sonst könnte sie in dieser Form gar nicht existieren. In der zweiten Gruppe läuft dagegen viel mehr nach den Regeln des freien Marktes ab. Ein besonders eindrückliches Beispiel hierfür sind die Orchesteraushilfen: Während die Gehälter der fest angestellten OrchestermusikerInnen in der Regel durch die öffentlichen Fördermittel gedeckt sind, gelten Aushilfsgagen als „Betriebskosten“, die z.B. durch Kartenverkäufe gegenfinanziert werden müssen. Es verwundert daher nicht, dass die meisten Orchester versuchen, diese Kosten so gering wie möglich zu halten bzw. sie gar nicht in der Lage sind, faire Bezahlungen durch ihre Einnahmen zu decken.
Unterrichten – nur eine Nebentätigkeit?
Leider stellt eine Tätigkeit als MusikschullehrerIn oder Orchesteraushilfe für viele MusikerInnen der ersten Gruppe tatsächlich nur eine Zusatzbeschäftigung dar. Nicht wenige fest angestellte MusikerInnen unterrichten nebenher noch ein bisschen privat oder spielen gelegentlich als Aushilfe in anderen Orchestern. Manche haben auch ohne finanzielle Not zwei oder mehr Jobs. Das alles muss in unserer Branche angeblich so sein, um „die Karriere“ voranzutreiben. Diese Art des Unterrichtens gilt dann doch wieder als „ehrenvoll“. Was gibt es schließlich honorigeres, als das eigene Wissen an künftige Generationen weiterzugeben? Es gibt viele MusikerInnen, die fest in einem Orchester angestellt sind und nebenher noch eine Professur innehaben. Wir haben einige Jahre Berufserfahrung gebraucht, um zu erkennen, dass diese Art Mehrfachanstellung in anderen Branchen absolut unüblich ist. Juristisch ist das auch nicht unproblematisch: In der Regel ist man ArbeitgeberInnen gegenüber auskunftspflichtig über etwaige Nebeneinkünfte; manche Arbeitnehmerschutz-Regelungen wie die Einhaltung von Ruhezeiten gelten übergreifend für alle Tätigkeiten. Doch anscheinend kann man das alles noch toppen: Uns wurde berichtet, dass manche fest angestellten MusikerInnen Zusatzbeschäftigungen wie Mucken komplett ohne Bezahlung ausführen. Weil es für sie – ganz im Sinne der römischen Rechtsberater – eine solche Ehre ist. Für die freien MusikerInnen, die auf solche Einnahmen angewiesen sind, zerstört es leider den Arbeitsmarkt.
Viele MusikerInnen der zweiten Gruppe schweigen dazu; sie schämen sich, weil sie ihrer Meinung nach der Musik nicht gerecht geworden sind. In ihren Köpfen ist das Unterrichten auch nur eine Nebentätigkeit – die sie leider in Vollzeit ausüben müssen, weil es mit der Karriere „nicht so geklappt“ hat. Dass sie hervorragende pädagogische Arbeit leisten, kann ihre Minderwertigkeitskomplexe kaum verringern. Das hält sie davon ab, sich für ihre Rechte einzusetzen und gegen die schlechten Arbeitsbedingungen zu protestieren. Diese zweite Gruppe wird immer größer. Allein im Zeitraum von 2000 bis 2012 hat sich die Zahl der AbsolventInnen an deutschen Musikhochschulen um 43 % erhöht, während die Zahl der festen Stellen, beispielsweise in Orchestern, zurückgegangen ist. Als Konsequenz stieg die Zahl der freiberuflichen MusikerInnen von 1992 bis 2015 um 250 %. Etwa 70 % der deutschen MusikhochschulabsolventInnen gab 2014 in einer Studie an, sie seien im Studium schlecht zu beruflichen Perspektiven beraten worden.[5]Die Angaben stammen aus einer bundesweiten Studie der Oboistin und Musikforscherin Esther Bishop. Die Ergebnisse wurden im Artikel „Nach uns die Sintflut“, veröffentlicht am 29.08.2018 auf van.atavist.com, besprochen. Diese Entwicklung ist an Teilen der Musikszene anscheinend unbemerkt vorbeigezogen – der Ausbildungsfokus liegt an deutschen Musikhochschulen nach wie vor auf den solistischen Fähigkeiten und dem Orchesterspiel.
Das Bild der klassischen Musik, welches in unseren Köpfen vorherrscht, hat mit dem Berufsalltag der meisten MusikerInnen nichts mehr zu tun. In den letzten Jahrzehnten hat die Aufführung von Musik in den klassischen Formaten an Bedeutung verloren, während die Pädagogik immer wichtiger geworden ist – eigentlich, denn mit dem Verlust des Status als Popmusik ging auch ein Realitätsverlust einher. Daher wurde der Zustand, in dem wir uns in den 1960ern befanden, quasi eingefroren und konserviert. Das trifft neben dem oben beschriebenen Bild auch auf die pädagogischen Standards zu, die an Musikhochschulen und teilweise auch an Musikschulen gelten. An der #metoo-Debatte lässt sich ablesen, dass manche LehrerInnen noch heute unterrichten wie vor 70 Jahren. Einige der schlimmsten Auswüchse dieser „Pädagogik“ haben wir kürzlich in unserem Beitrag „Du spielst wie Müll“ für den „Bad Blog Of Musick“ der nmz gesammelt.[6]Laura Oetzel & Daniel Mattelé: „Du spielst wie Müll“, veröffentlicht am 20.01.2021 auf blogs.nmz.de/badblog/
Unterstützung für freie KünstlerInnen?
Es ist nicht so, dass es keine MusikerInnen der „ersten Gruppe“, wie wir sie genannt haben, gibt, die sich für die Belange der „zweiten Gruppe“ einsetzen. Der Komponist Matthias Hornschuh kritisiert in einem Beitrag für die FAZ beispielsweise den Umgang des Staates mit den KünstlerInnen.[7]Matthias Hornschuh und Nina George: „Denn sie wissen nicht, was wir tun“, veröffentlicht am 30.01.2021 auf faz.net Er bemängelt, dass die KünstlerInnen nicht als ganz normale SteuerzahlerInnen oder UnternehmerInnen gesehen würden, sondern in die Schublade „LebenskünstlerInnen“ gesteckt würden. Doch auch bei solchen Fürsprechern der freien Szene kann man unserer Meinung nach das veraltete Selbstbild der MusikerInnen erkennen. So meint Hornschuh beispielsweise, ein Gitarrist würde vom Urheberrecht leben. An anderer Stelle schreibt er, KünstlerInnen verstünden sich als Teil einer „Symbiose, mit Labels, Verlagen, Bühnen“. Damit zieht er exemplarisch die Grenze zwischen Kreativschaffenden und MusiknutzerInnen dort, wo sie vielleicht vor einigen Jahrzehnten verlief: Die MusikerInnen befinden sich alle auf der profitierenden Seite der Rechteverwertung, die Musiknutzer auf der zahlenden. Aus dieser Vorstellung heraus kritisiert er die Gesetzgeber: Um den Selbstständigen zu helfen, müssten sie die RechteinhaberInnen stärken, zum Beispiel durch ein besseres Urheberrecht.
Das ist unserer Meinung nach ein Fehlschluss, denn im Berufsalltag profitieren eben nicht alle MusikerInnen von der Rechteverwertung. Jede(r) InstrumentallehrerIn dürfte beispielsweise das Problem kennen, dass Noten für SchülerInnen zwar nicht kopiert werden dürfen, gekaufte Noten für jede(n) einzelne(n) SchülerIn aber viel zu teuer sind. Als Lösung dieses Problems schreiben viele LehrerInnen selbst Übungsstücke für ihre SchülerInnen – eine Arbeit, die ihnen im Zuge eines Honorarvertrags nicht vergütet wird. Oder sie kopieren eben doch unerlaubterweise geschützte Werke. Für Musikschulen gibt es inzwischen einen Pauschalvertrag mit der GEMA, um dieses Problem zu lösen.[8]„Fotokopieren in Musikschulen: GEMA und VG Musikedition schließen Pauschalvertrag mit Bundesverband der Freien Musikschulen“, veröffentlicht am 22.01.2018 auf freie-musikschulen.de Dieser existiert allerdings erst seit 2018. PrivatlehrerInnen stehen nach wie vor diesem Problem. Ein anderes Beispiel haben wir in unserem Artikel „Musik mit Staubflocken dran – Begegnungen mit der GEMA“[9]Laura Oetzel & Daniel Mattelé: „Musik mit Staubflocken dran – Begegnungen mit der GEMA“, veröffentlicht am 09.08.2019 auf dasharfenduo.de beschrieben: Wenn man als MusikerIn selbst ein Konzert veranstaltet, das nicht subventioniert wird, können die GEMA-Gebühren den gesamten Gewinn auffressen. Im veralteten Bild der klassischen Musik kommt dieser Fall nicht vor, denn hier wird man natürlich von VeranstalterInnen, die auch die GEMA-Gebühren bezahlen, engagiert. Man kann als freie(r) KünstlerIn heutzutage aber nicht endlos darauf warten, dass man für Auftritte engagiert wird, weil es einfach zu viele freie KünstlerInnen gibt. Mit anderen Worten: Viele MusikerInnen der „zweiten Gruppe“ müssen sich beruflich breiter aufstellen und stehen mittlerweile auf beiden Seiten der Rechteverwertung – wenn überhaupt: Es gibt bestimmt viele MusikerInnen, die in ihrer ganzen Karriere keinen Cent durch Rechteverwertung verdienen (so wie wir, das Harfenduo!).
Und es gibt einen weiteren Fehlschluss in dieser Argumentation, mit dem wir wieder auf den Anfang dieses Artikels zurückkommen: Der Gesetzgeber hat überhaupt kein Interesse daran, die Arbeitsbedingungen für selbstständige KünstlerInnen zu verbessern. Das würde nämlich bedeuten, dass die Freiberuflichkeit eine ernsthafte Alternative zur Festanstellung würde, was die gesetzliche Rentenversicherung sich nicht leisten kann. „Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative“ formuliert es Sascha Lobo im SPIEGEL etwas überspitzt.[10]Sascha Lobo: „Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative“, veröffentlicht am 19.12.2020 auf spiegel.de Matthias Hornschuhs Engagement für die Selbständigen ist aller Ehren wert und wir möchten ihm – trotz seines Aufsichtsratsposten bei der GEMA – auch keinen einseitigen Lobbyismus unterstellen. Doch auch bei so einem gut gemeinten Engagement besteht immer die Gefahr, dass Verbesserungen nur denen nützen, die so gut von der Freiberuflichkeit leben können, dass sie tatsächlich keine Festanstellung wollen oder brauchen. Das trifft aber nur auf ganz wenige der Szene zu. Wenn man dagegen Umfragen an Musikschulen durchführt, ob man lieber fest angestellt wäre, dürfte dem die überwiegende Mehrheit zustimmen. Die Verbesserung der Arbeitsbedingen für Honorarkräfte stellt für sie nur eine Übergangslösung dar.
Wer hat überhaupt ein Interesse an besseren Arbeitsbedingungen?
Die GeldgeberInnen von Kultureinrichtungen haben kein Interesse daran, die Breite des Kulturangebots auf Kosten besserer Arbeitsbedingungen einzuschränken. Im Musikschulbereich konnten durch Projekte wie „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKI) bzw. dessen Nachfolger „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ (JeKits)[11]vgl. Wikipedia-Eintrag „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ Kinder erreicht werden, die sonst keinen Zugang zu Musik gehabt hätten. Quantität statt Qualität ist die Devise – aktuell im Trend sind Kooperationen mit Kitas und Grundschulen im Bereich der musikalischen Früherziehung. Das ist nur durch den flächendeckenden Einsatz von überqualifizierten Honorarkräften bzw. deren Selbstausbeutung möglich. Ein Umdenken ist erst zu erwarten, wenn die Musikschulen keine KünstlerInnen mehr finden, die bereit sind, unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Das gleiche trifft auf andere ArbeitgeberInnen zu, zum Beispiel die Orchester: Wir haben es oft erlebt, dass das Niveau vor allem kleinerer Orchester durch den exzessiven Einsatz von externen Aushilfen stieg, obwohl sie nur ein Bruchteil von dem verdienten, was die fest angestellten MusikerInnen bekamen. Für die Orchester eine Win-Win-Situation: Sie sparen durch die Stellenkürzungen bares Geld, doch das Niveau und damit das Ansehen des Orchesters steigt. Auch sind so selbst in kleinen Orchestern publikumswirksame Projekte mit riesigen Besetzungen möglich. Man könnte nun glauben, dass die Dienste einer Aushilfe dadurch besonders geschätzt würden, doch leider ist das Gegenteil der Fall: Oft werden Aushilfen überkritisch beurteilt und sind nicht selten Mobbing und Ausgrenzung ausgesetzt. Auch hier wird das Ansehen und damit die Bezahlung erst dann aufgewertet werden, wenn kein Überangebot an Aushilfen mehr existiert, aus dem man sich die Rosinen herauspicken kann.
Das dürfte erst dann erreicht werden, wenn wir an unseren Musikhochschulen deutlich weniger MusikerInnen ausbilden und die Ausbildung besser am aktuellen Berufsbild ausrichten. Das ist leichter gesagt als getan, denn die Musikhochschulen müssten damit zumindest kurzfristig gegen ihre eigenen Interessen handeln. Vom Überangebot des Marktes profitieren letztendlich auch sie selbst. Es ist schwer zu beurteilen, ob der massive Ausbau des Angebots an Musikhochschulen und die damit steigende Anzahl an AbsolventInnen eine Folge des Arbeitsmarktwandels war oder umgekehrt. Wahrscheinlich war es ein Teufelskreis, der für beide Seiten zu viele Vorteile hatte, um die langfristigen Folgen zu bedenken. Doch die Musikhochschulen wären in der Lage, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Die Zahl der AbsolventInnen ließe sich schon ganz am Anfang des Studiums durch eine Verschärfung der Aufnahmeprüfung reduzieren. In den letzten Jahren geschah leider das Gegenteil: An vielen Hochschulen wurden und werden zunehmend (gut bezahlte) Stellen für exotische Instrumente und Nebenfächer geschaffen, für die es zwar keinen Arbeitsmarkt gibt, die aber dem Haus den Ruf eines weltoffenen und allumfassenden Bildungstempels einbringen.
Und nun?
Fassen wir zusammen: Wenn wir etwas an den Arbeitsbedingungen der KünstlerInnen verbessern wollen, sind höhere Honorare auf Dauer nicht die Lösung. Der Staat als Geldgeber vieler Kultureinrichtungen hat kein Interesse daran, die Selbstständigkeit attraktiver zu machen, weil er sich dies wegen des möglicherweise verfassungswidrigen Zuschusses aus Steuermitteln zur Rentenkasse nicht leisten kann. Eine Einschränkung des Angebotes, welche mit der Rückkehr zur Festanstellung vermutlich einhergehen würde, wird nicht freiwillig erfolgen. Daher ist aus dieser Richtung langfristig keine Hilfe zu erwarten, im Gegenteil: Grundsätzlich wäre es für die Rentenkasse besser, wenn die Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte oder Orchesteraushilfen schlecht blieben, damit sie sich andere, feste Jobs suchen oder diese Tätigkeiten als Nebenjobs zu einer Festanstellung ausüben.
Wenn wir bessere Arbeitsbedingungen für viele und nicht nur einzelne haben wollen, werden wir als klassische Musikszene in Zukunft besser zusammenarbeiten müssen. Dazu müssen wir endlich das veraltete Bild der 1950er und 1960er Jahre aus unseren Köpfen bekommen! Die Welt hat sich weiterentwickelt: Vollzeit-MusiklehrerInnen sind nicht mehr die gescheiterten SolistInnen, sondern die Eckpfeiler der Szene. Sie ermöglichen der ganzen Gesellschaft einen Zugang zur klassischen Musik, indem sie Kindern zeigen, wie wunderbar und vielseitig sie sein kann. Eindimensionale Sinfoniekonzerte und völlig abgehobene Operninszenierungen sind schon lange nicht mehr das Zugpferd der klassischen Musik. Diese Erkenntnis muss sich in den Musikhochschulen durchsetzen. Dort entscheidet sich letztendlich, welches Bild wir MusikerInnen in Zukunft abgeben werden. Wir fordern die Musikhochschulen auf, sich der Verantwortung, die sie für die gesamte Szene haben, zu stellen!
Bis es soweit ist, können wir MusikerInnen im Kleinen selbst überlegen, was wir zur Verbesserung beitragen können. Muss ich als OrchestermusikerIn wirklich noch drei Musikschulstellen haben, auch wenn ich von meinem Orchestergehalt eigentlich gut leben kann? Muss ich als ProfessorIn wirklich ständig Aushilfe in Orchestern spielen und dabei noch nicht mal nach Fahrtkosten fragen? Muss ich als SolistIn wirklich eine fünfstellige Gage bekommen, während meine Ensemblekollegen mit 100 € und einem warmen Händedruck abgespeist werden? Wir hoffen, dass durch diesen Artikel der eine oder die andere zum Nachdenken angeregt wird und eine (oder alle…) dieser Fragen mit „Nein“ beantworten kann. Das würde schon jetzt die Arbeitsmarktsituation für viele freie MusikerInnen dramatisch verbessern.
Laura & Daniel
Quellen und Anmerkungen
| ↑1, ↑10 | Sascha Lobo: „Der deutsche Staat verachtet Selbstständige und Kreative“, veröffentlicht am 19.12.2020 auf spiegel.de |
|---|---|
| ↑2 | vgl. Wikipedia-Eintrag „Honorar“ |
| ↑3 | „Nachgefragt: Honorarkräfte der Rheinischen Musikschule wehren sich!“, veröffentlicht am 31.07.2018 auf koeln-bonn.dgb.de |
| ↑4 | Will Cheng: Loving music till it hurts, Oxford University Press, 2019, S. 20-27 |
| ↑5 | Die Angaben stammen aus einer bundesweiten Studie der Oboistin und Musikforscherin Esther Bishop. Die Ergebnisse wurden im Artikel „Nach uns die Sintflut“, veröffentlicht am 29.08.2018 auf van.atavist.com, besprochen. |
| ↑6 | Laura Oetzel & Daniel Mattelé: „Du spielst wie Müll“, veröffentlicht am 20.01.2021 auf blogs.nmz.de/badblog/ |
| ↑7 | Matthias Hornschuh und Nina George: „Denn sie wissen nicht, was wir tun“, veröffentlicht am 30.01.2021 auf faz.net |
| ↑8 | „Fotokopieren in Musikschulen: GEMA und VG Musikedition schließen Pauschalvertrag mit Bundesverband der Freien Musikschulen“, veröffentlicht am 22.01.2018 auf freie-musikschulen.de |
| ↑9 | Laura Oetzel & Daniel Mattelé: „Musik mit Staubflocken dran – Begegnungen mit der GEMA“, veröffentlicht am 09.08.2019 auf dasharfenduo.de |
| ↑11 | vgl. Wikipedia-Eintrag „JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ |
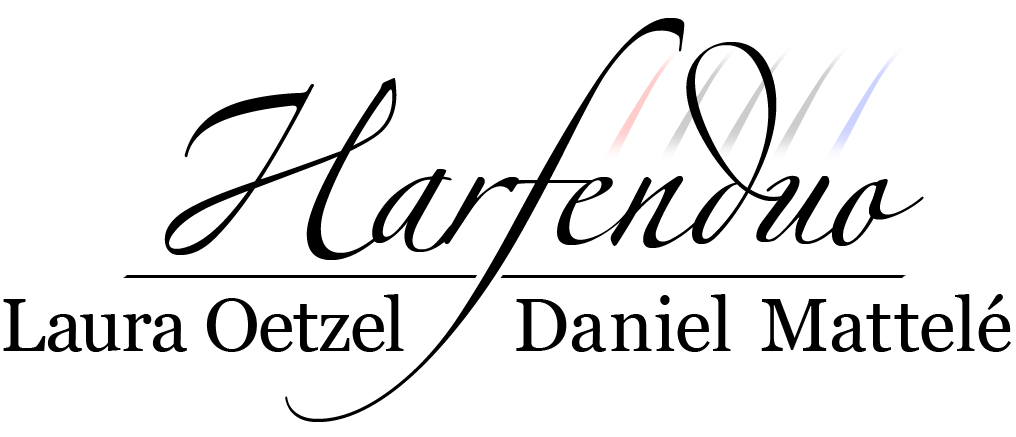



4 Comments
Schöne neue Welt….. das würde ich uns FreiberuflerInnen wirklich wünschen, aber ich bin skeptisch. Ich glaube, dass die Einteilung in „die es geschafft“ und „die es nicht geschafft haben“ immer noch sehr präsent und den Berufsalltag bestimmend ist. Dabei sind FreiberuflerInnen in der Kulturszene (aus reiner Notwendigkeit) sehr viel flexibler, vielseitiger und kreativer als die etablierten KollegInnen. Eigentlich DIE Chance, frischen Wind in verstaubte Strukturen zu bringen. Schaun wir mal.
Ein hervorragender Beitrag!! Weiter so!
Vielen Dank für die aufmunternden Worte! Wir haben das Gefühl, dass sich langsam etwas tut, vielleicht können wir ja auch dazu beitragen, wie die freie Szene in der Zukunft aussehen wird.
Laura & Daniel
Ein sehr interessanter und lehrreicher Artikel. Danke dafür. Vor 1,5 Monaten habe ich meinem Honorardasein für immer den Rücken gekehrt und den Beruf gewechselt- nach 22 Jahren. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich fest angestellt, habe Anspruch auf 13. Gehalt und betriebliche Altersvorsorge. Danke, deutscher Staat. Ich kehre nie mehr zurück in mein altes Leben. Erst jetzt merke ich, was Respekt heißt. Das sind die Rahmenbedingungen, damit fängt überhaupt die Menschenwürde an. Übrigens habe ich meine musikpädagogische Tätigkeit niemals als gescheiterte Karriere oder Nebentätigkeit betrachtet. Ich habe diesen Beruf, für den ich auch ausgebildet wurde, geliebt. Und ein paar Schüler werde ich weiter unterrichten, nur so…
Hallo Harfenblume,
herzlichen Glückwunsch erstmal zu Deinem neuen Beruf! Ein mutiger Schritt. Genieße den Segen einer Festanstellung. Es ist aber ein herber Verlust für die Musikwelt, dass sie engagierten PädagogInnen wie Dir keinen Respekt und keine Sicherheit bieten konnte.
Viele Grüße
Laura & Daniel