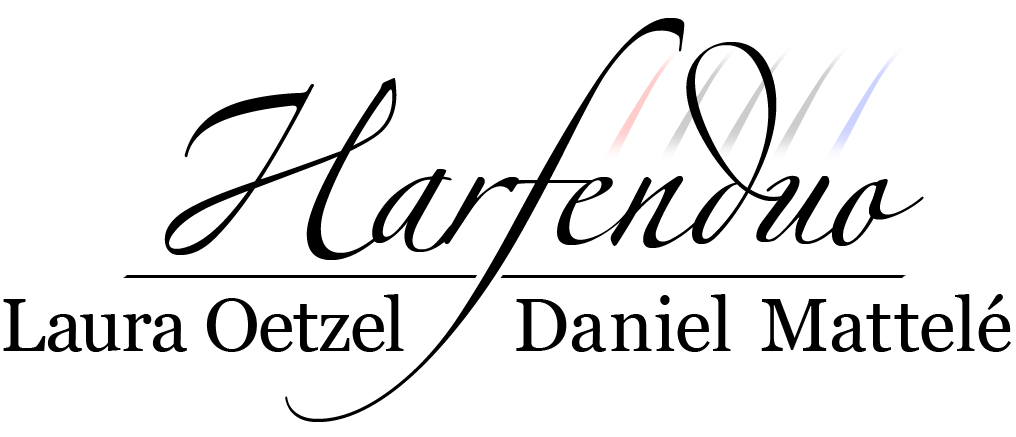Daniel hat die Musikethnologin Lena Meiertoberend in Würzburg interviewt. Lena forscht zum Thema Straßenmusik und hat darüber sowohl ihre Bachelor- als auch ihre Master-Arbeit geschrieben.
Ich bin hier heute in Würzburg und spreche mit der Musikethnologin Lena Meiertoberend. Hallo Lena!
Hallo!
Erzähl doch mal: Wie bist Du dazu gekommen, über Straßenmusik zu forschen?
Straßenmusik hat mich schon immer fasziniert. Ich erinnere mich daran, dass wir als Kinder, wenn wir durch Hamburg gelaufen sind, immer bei den Straßenmusiker*innen stehengeblieben sind. Da gab es eine Gruppe, die hatten einen Kontrabass, eine Gitarre, eine Flöte und ein Schlagzeug dabei, was sie aus einem alten Koffer gebaut hatten. Die haben immer am selben Platz gestanden. Das hat mich total angezogen! Unbewusst war Straßenmusik immer präsent. Im dritten Semester meines Ethnologie-Studiums sollten wir dann eine Praxiserfahrung machen. Es sollte eine kleine Feldforschung werden, und die einzige Vorgabe war, dass es irgendwas mit der Stadt zu tun haben musste. Die Dozentin meinte, wir sollten einfach rausgehen und gucken, was uns ins Auge springt. Mir ist dann direkt ein Straßenmusiker ins Auge gesprungen. Ich habe mit ihm ein Interview geführt, und seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Mittlerweile kann ich nur noch ganz selten durch die Stadt gehen, ohne zu denken: „Da ist ein Straßenmusiker, den muss ich ansprechen.“
Das glaube ich gerne! Das geht doch bestimmt jedem so, dass man aus der Kindheit einzelne Bilder von Straßenmusik vor Augen hat. In Köln auf der Schildergasse zum Beispiel gibt es einen Drehorgel-Spieler, der relativ auffällig ist. Zum einen wegen seines Instruments, zum anderen aber auch, weil er eine körperliche Behinderung hat. Der steht da seit ich ganz klein war. Wenn man das erlebt hat, dann vergisst man das nicht mehr.
Ja, und es ist tatsächlich so, dass viele Kinder stehen bleiben und sich von der Straßenmusik angezogen fühlen. In meiner Forschung war es spannend zu beobachten, dass dann teilweise eher die Eltern versucht haben, die Kinder davon wegzulocken – gerade wenn es Straßenmusiker waren, die vielleicht auf den ersten Blick etwas „heruntergekommen“ wirkten. Die Kinder waren aber von der Musik so fasziniert, dass sie gar nicht weitergehen wollten.
Welche Reaktionen auf Straßenmusik konntest Du noch beobachten?
Das war tatsächlich sehr durchwachsen. Die Reaktion auf Straßenmusik an sich fällt hier in Würzburg recht positiv aus, weil es mit dem StraMu eines der größten Straßenmusikfestivals Europas gibt. Da gelten natürlich Qualitätsstandards und es wird gezielt ausgewählt, wer auftreten kann. Damit hat es nicht mehr so viel mit der eigentlichen Straßenmusik zu tun, die ja eigentlich ohne Qualitätsstandards funktionieren sollte. Es gibt Städte in Deutschland, die trotzdem Qualitätsstandards für Straßenmusik festlegen. In München ist das beispielsweise sehr streng geregelt. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber vor Corona mussten Straßenmusiker*innen vorspielen, um eine Erlaubnis zu bekommen, in der Stadt spielen zu dürfen. Das schränkt die Idee der Straßenmusik, die ja alle auf die Straße bringen sollte, natürlich ein. Allerdings hat man damit auch nicht mehr das Problem der Bettel-Musiker*innen. Auch bei meiner Forschung gab es dieses Bild von Straßenmusik als Bettelei. Ein paar Interviewpartner*innen haben sogar von organisierter Bettelei gesprochen. Das konnte ich allerdings nicht bestätigen. Und tatsächlich wird die Bettelei oft mit osteuropäischen Straßenmusiker*innen in Verbindung gebracht, unabhängig davon, was deren musikalische Leistung ist. Das fand ich schon sehr spannend. Es gab einen Musiker aus Osteuropa, der im Interview darauf hingewiesen hat, er habe das Gefühl, dass er viel schneller den Platz räumen müsse als Musiker*innen, die beispielsweise spanische Musik mit Stereotypen aus südeuropäischen Regionen machen.
Den Platz wechseln? Ich kann nicht einfach so mein Instrument nehmen und mich dann in die Fußgängerzone stellen?
Offiziell nicht. In den meisten Städten braucht man eine Genehmigung, die zum Beispiel vom Ordnungsamt erteilt wird. Viele Städte haben auch eine maximale Anzahl an Genehmigungen, die sie pro Tag verteilen, und in einigen Städten muss man tatsächlich für diese Genehmigung zahlen.
Das heißt, ich muss da morgens zum Ordnungsamt hingehen und mir eine Genehmigung holen, die dann auch nur für den einen Tag gilt.
Genau! Die Genehmigung müsste man im Fall der Fälle vorweisen können, wenn man vom Ordnungsamt angesprochen wird.
Passiert das?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Straßenmusiker*innen, auf die ich für ein Interview zugegangen bin, Angst hatten, dass ich sie kontrollieren will. Insbesondere die, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren, sind den Gesprächen zu Beginn ausgewichen. Ich kam auf sie zu und habe gefragt, ob ich ihnen Fragen stellen dürfte, und dann haben sie ihre Sachen zusammengepackt und waren weg. Irgendwann wurde es dann leichter. Vielleicht haben sie mich mit anderen Straßenmusiker*innen im Gespräch gesehen. Aber da war offenbar die Sorge vorhanden, dass ich jetzt irgendwas kontrollieren würde.
Gibt es denn eine Straßenmusik-Szene, wo man sich untereinander trifft, wo man sich auch austauscht? Vielleicht haben die den anderen ja erzählt, dass Du „harmlos“ bist.
Zumindest hier kam von den meisten Straßenmusiker*innen die Aussage, dass sie eigentlich nicht so gut miteinander vernetzt sind. Man sieht sich teilweise eher in Konkurrenz. Vielleicht ist das in Großstädten anders. Der Musikethnologe Mark Nowakowski hat ein sehr spannendes Buch über Straßenmusik in Berlin mit sehr vielen Fallbeispielen geschrieben. Darin thematisiert er auch die Vernetzung unter den Musiker*innen. Hier in Würzburg sind jetzt natürlich auch nicht ganz so viele Straßenmusiker*innen unterwegs wie in Berlin. Daher läuft alles etwas ruhiger ab.
Aber Ärger gibt es bestimmt trotzdem gelegentlich, oder?
Es kann natürlich immer mal passieren, dass sich Anwohner*innen oder Geschäftsinhaber*innen gestört fühlen und dann irgendwann auch dem Ordnungsamt Bescheid geben. In Würzburg müssen die Musiker*innen zum Beispiel alle halbe Stunde weiterziehen. Es gibt welche, die das machen, aber es gibt auch solche, die zwei oder drei Stunden am selben Platz stehen und drei Lieder in Dauerschleife spielen. Das Ordnungsamt meinte aber, dass es nur ganz selten vorkommt, dass eine Verwarnung nicht ausreicht.
Was mögen die Leute an Straßenmusik? Was finden sie vielleicht nicht so gut?
Da kommt es immer darauf an, in welcher Situation das Publikum gerade ist. Ist es Publikum, was stehenbleibt? Oder sind es ein Passant*innen, die den Weg nur nutzen, um irgendwo hinzukommen? Dann kann Straßenmusik natürlich auch nervig sein. Es bilden sich zum Beispiel Menschentrauben und man kommt mit dem Fahrrad nicht durch.
Ich persönlich finde es immer schwierig, wenn Leute in der Straßenbahn Musik machen, weil man der Situation dann ja nicht ausweichen kann. Es ist eng, es ist laut. Das kann dann schon ein bisschen unangenehm sein.
Diese Rückmeldung habe ich auch oft bekommen: Straßenmusik ist schön, wenn man selbst entscheiden kann, ob und wie lange man zuhört.
Das ist ja meistens so bei Musik…
Aber zu einem Konzert geht man ja hin, um sich schöne Musik anzuhören. Auf der Straße wird man einfach damit konfrontiert. Das bringt natürlich wahnsinnig viele Vorteile im Bereich Kulturvermittlung und dergleichen mit sich, weil so ein sehr niedrigschwelliges Angebot entsteht. Aber wenn man vielleicht nicht entspannt durch die Stadt bummelt und sagt, man hat jetzt Zeit, fünf bis zehn Minuten zuzuhören, sondern in Eile ist, dann verliert es diesen Freiwilligkeitscharakter. Oft stehen Straßenmusiker*innen vor Cafés, und wenn man da dann seinen Kaffee trinken will oder sich nicht mehr so gut unterhalten kann, wird das schnell als unangenehm empfunden. Manche Musiker*innen gehen anschließend zu den Leuten und bitten aktiv um Spenden. Auch das stört manche Leute.
Apropos Geld: Was kann man denn mit Straßenmusik verdienen?
Es kommt stark drauf an, wo man spielt und was man spielt. Ich habe hier Straßenmusiker*innen kennengelernt, die davon leben konnten. Aber letztendlich ist es auch immer so ein bisschen die Frage, was deren Intention ist. Ist es die Intention, Geld zu verdienen? Ist man darauf angewiesen, oder ist es ein ein netter Zusatzverdienst?
Im letzten Fall ist dann vielleicht der Druck nicht so hoch.
Meiner Meinung nach kann man das den Musiker*innen auch anmerken, ob der finanzielle Aspekt im Vordergrund steht. Das erkennt man zum Beispiel an diesem aktiven Geldsammeln. Aber auch die Art und Weise, wie sie sich präsentieren, spielt eine Rolle. Es gab Straßenmusiker*innen, die darauf hingewiesen haben, dass sie in „Verkleidung“ spielen, weil es authentischer wirkt und damit finanziell mehr einbringt. Da war zum Beispiel ein Hand Drum Spieler, der hat mir gesagt, sein Arbeitsoutfit für die Straße sei eine weiße Leinenhose und ein weißes Leinenhemd. Dazu saß er barfuß da. Er habe die Erfahrung gemacht hat, dass das richtig gut ankomme. Die Leute halten das für authentisch: Er sei da so in seiner Musik gefangen und die optische Erscheinung passe perfekt dazu. Da gibt es schon Straßenmusiker*innen, die richtige Shows abziehen, um mehr Aufmerksamkeit zu generieren und damit auch mehr einzunehmen. Je größer die Show, desto weniger wird am Ende auf die Musik geachtet. Manche Straßenmusiker*innen gucken, was für ein Publikum gerade unterwegs ist, um daran ihre Stückauswahl danach zu richten. Sie spielen dann nicht, was sie vielleicht gerade gerne spielen möchten, also was sie selber an Bedürfnissen haben, sondern zum Beispiel Filmmusik, wenn junge Leute vorbeigehen. Man versucht dann, die so „einzufangen“. Wenn es älteres Publikum ist, dann kann es auch mal was von Mozart sein, damit sie stehenbleiben. Das fand ich sehr spannend, weil man ja eigentlich davon ausgeht, dass die Straßenmusiker*innen in dieser Frage frei sind. In Wahrheit sind sie eigentlich doch diesen Abhängigkeiten unterworfen.
Ich finde, das klingt nach einem ziemlich harten Geschäft. Wir haben mal einen Podcast mit Jeffrey Amankwa gemacht, der in Soul- und Funk-Bands singt. Er meinte, dass er oft Anfragen bekommt wie: Wir brauchen einen Sänger, der muss aber schwarz sein, weil das authentischer ist. Er hat erzählt, dass er vor allem am Anfang seiner Karriere mehr Anfragen bekommen habe, weil er eine person of color ist, als wegen seiner schönen Soul-Stimme. Ich finde das irgendwie krass, dass das selbst in der Straßenmusik so ist. Man setzt sich eine lustige Perücke auf oder zieht eine weiße Leinenhose an, und schon denken die Leute: Ah ja, das passt so für mich. Das sagt auch was über das Publikum aus…
Das ist auf jeden Fall so! Wenn das Publikum das Gefühl hat, es sei authentisch, dann ist es oft völlig ausreichend. Der spanische Musiker, der Flamenco spielt und sich dementsprechend präsentiert, wird in den höchsten Tönen gelobt. Noch Jahre später wird von dem berichtet. Die Leute haben mir erzählt: Vor zwei Jahren war der hier, der sah so authentisch aus, das war ein Spanier durch und durch. Wenn ich dann frage: Ja, und wie finden sie die Musik jetzt im Moment? Dann heißt es: Das ist ein osteuropäischer Musiker, und das sieht man ihm ja auch an.
Das wäre jetzt gut, wenn der Spanier eigentlich aus der Ukraine kam…
Kann durchaus sein! Aber wie auch immer: Diese Wahrnehmung spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle: Wie wirkt der Straßenmusiker oder die Straßenmusikerin?
Du sagst jetzt Straßenmusikerin, aber es sind fast überwiegend Männer, oder?
In dem Jahr, in dem ich die Interviews geführt habe, sind mir nur zwei Frauen begegnet. Auch sonst bin ich ja immer wieder in der Stadt und halte nach Straßenmusik Ausschau. Es ist schon sehr auffallend, dass es überwiegend männliche Musiker sind.
Woran liegt das?
Eine richtige Erklärung habe ich dazu auch nicht. In der Forschung von Mark Nowakowski war das auch auffallend. Er vermutet, dass es vielleicht daran liegt, dass die Straße einfach ein hartes Pflaster ist. Letztendlich bleibt die Frage bei mir aber noch offen. Ich würde gerne noch mal mit dieser Frage auf die Straße gehen und schauen, warum die Szene so männlich dominiert ist. Es wäre auch spannend zu erfahren, ob das tatsächlich überall so ist.
Die Forschung ist also noch nicht beendet.
Das Thema Straßenmusik gibt so viel her! Ich fand es ganz schwer, mich zu beschränken. Ich habe so viel Interessantes erfahren! Man spricht dann ja auch mit Personen, die ganz unterschiedliche kulturelle Kontexte haben. Ich hatte in den ersten Interviews Straßenmusiker, die sich selber als Kulturvermittler bezeichnet haben oder sogar von einer Kultur der Straße gesprochen haben. Das fand ich spannend und habe es in meinen Fragenkatalog aufgenommen. Dann hatte ich einen Straßenmusiker aus Mexiko, der bei der Frage, ob Straßenmusik Teil einer Kultur der Straße sei, völlig entsetzt war. Er meinte, nein, in Deutschland gäbe es keine „Kultur der Straße“; hier tanzt man nicht zusammen auf der Straße, hier lacht man nicht zusammen auf der Straße, hier isst man nicht zusammen auf der Straße. Durch diese kulturellen Kontexte wurde ganz unterschiedlich auf die Fragen reagiert.
Das heißt, du hattest einen Fragenkatalog, mit denen du an die Leute heran getreten bist.
Genau. Ich hatte einen Leitfaden vorbereitet, der dann aber flexibel nutzbar war. Es gab Straßenmusiker*innen, die von sich aus so viel erzählt haben, dass ich gar nicht mehr dazu kam, meine Fragen zu stellen. Es gab auch Fragen, die bei einzelnen Musiker*innen weniger passten. Generell gab es natürlich oft eine gewisse Sprachbarriere. Ich hatte Fragebögen auf Deutsch, Englisch und Russisch. Aber es sind schon viele Straßenmusiker*innen meinen Fragen wegen der Sprachbarriere „entkommen“.
Okay, die spannendste Frage zum Schluss: Hast du selber auch schon mal Straßenmusik gemacht?
Leider nicht.
Das heißt, diese Perspektive fehlt dir noch.
Ja, das ist super schade! Meine Geschwister machen auch Musik, und wir hatten als Kinder immer vor, uns auch mal auf die Straße zu stellen. Meine jüngere Schwester spielt Kontrabass, sie hat mit acht Jahren angefangen. Zu Beginn war das ganz süß, weil man sie hinter dem Kontrabass praktisch nicht sah.
Da hättet ihr bestimmt viel Geld mit verdient.
Da hätte es auf jeden Fall einen gewissen Niedlichkeits-Bonus gegeben. Aber irgendwie haben wir es immer nicht geschafft. Als ich im Zuge meiner Forschung das Thema wieder aufgenommen habe, habe gedacht, jetzt müsse ich mich einfach mal trauen. Als ich mich dann endlich dazu durchgerungen hatte, kam leider Corona. Damit war erst mal nichts mehr möglich. Ich muss gestehen, dass ich es danach dann auch wieder habe schleifen lassen. Die Arbeit musste fertig gestellt werden, und so hatte ich diese Perspektive leider nicht mit drin. Als die Arbeit fertig war, konnte ich wieder entspannt den Straßenmusikern zuhören und habe diese Idee nicht weiter verfolgt.
Das ist ja auch mal ganz schön, wenn man nur zuhören darf! Aber wie gesagt: Da ist noch Raum für weitere Forschung! Liebe Lena, ich bedanke mich ganz herzlich bei Dir für dieses Gespräch.